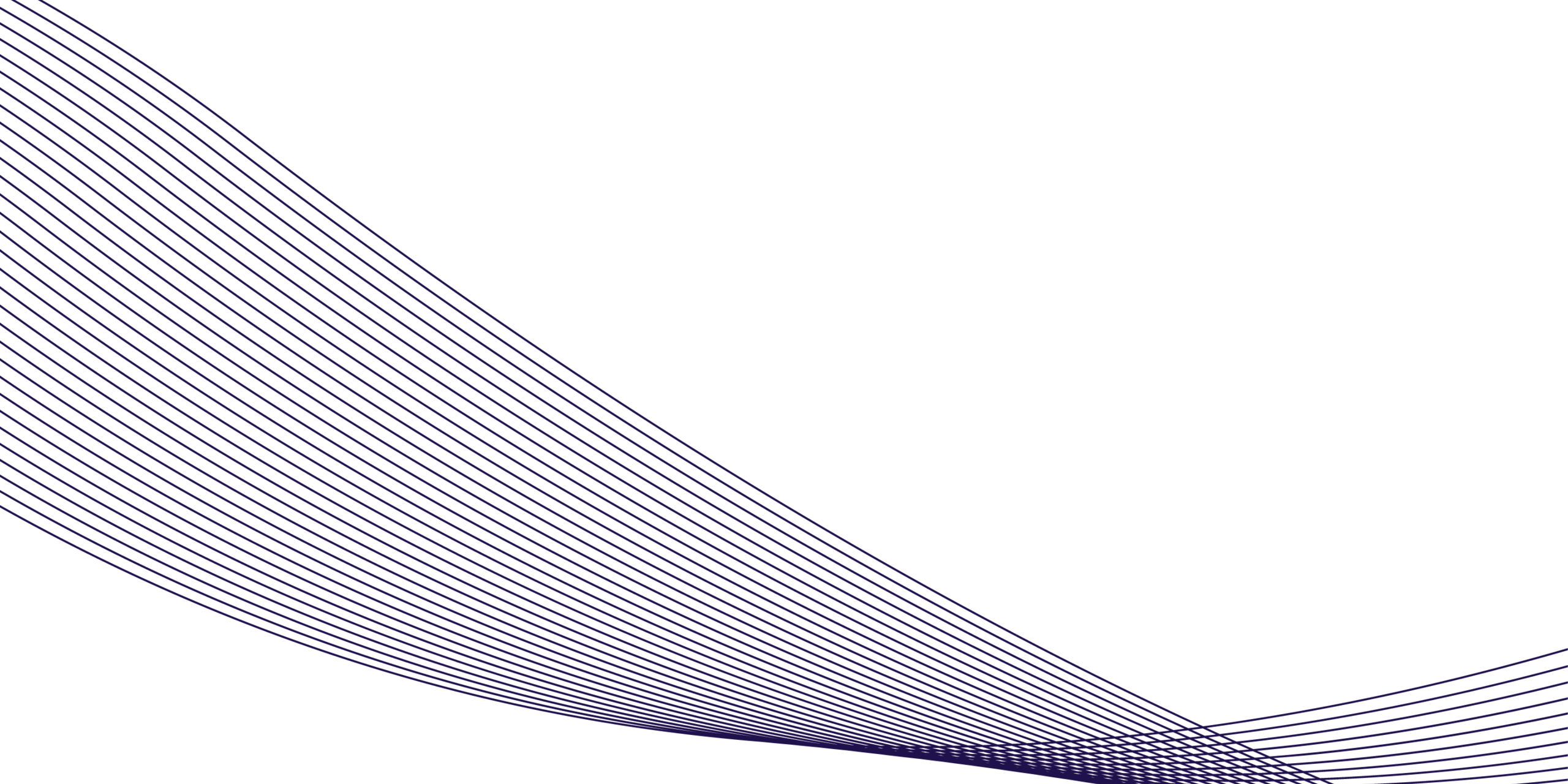Erfolgreiche Verteidigung einer privaten Hochschule gegen Klage wegen Nichtbestehens der Masterprüfung aufgrund von Täuschung
Der Kläger studierte bei unserer Mandantin im Masterstudiengang Internationales Management. Die erste von ihm eingereichte Masterthesis wurde mit nicht bestanden bewertet. Bei der Bewertung der Thesis, die er im zweiten und damit für ihn letzten Versuch eingereicht hatte, stellten die Prüfenden einen nicht den wissenschaftlichen Anforderungen genügenden Umgang mit den verwendeten Quellen und insbesondere eine nicht den wissenschaftlichen Standards genügende Zitierweise fest. Der Kläger hatte auch im Übrigen nicht gewissenhaft gearbeitet, was sich unter anderem daran zeigte, dass er aus anderen Werken übernommene Nummerierungen seiner Arbeit nicht angepasst hatte. Dennoch kamen die Prüfenden zu dem Ergebnis, dass die Arbeit noch mit ausreichend und damit bestanden bewertet werden und der Kläger zur mündlichen Prüfung geladen werden konnte.
In dem anschließenden Kolloquium wollte der Erstprüfer zunächst klären, ob die vielen Ungenauigkeiten und Fehler auf mangelnde Sprachkenntnisse oder inhaltliches Unverständnis zurückzuführen sind.
Der Kläger lud dazu die in seiner Thesis verwendeten Daten auf seinem Notebook hoch. Dabei fiel auf, dass diese Daten einer Datei entnommen waren, die nicht von dem Kläger selber erstellt worden war und aus einem Zeitraum stammte, der deutlich vor dem Zeitpunkt der Ausgabe des Themas der Thesis lag. Zudem räumte der Kläger ein, dass nicht er selber, sondern ein Freund diese Daten für ihn ausgewertet habe.
Weil der Kläger die Daten weder selber strukturiert noch selber ausgewertet hatte, stellte der Erstprüfer ihm eine Reihe von Fragen, um zu klären, ob er die Ergebnisse interpretieren kann. Dabei stellte sich heraus, dass der Kläger weder grundlegende Begriffe seiner Thesis erklären oder definieren konnte noch in der Lage war, die wesentlichen Zusammenhänge darzustellen. Das Kolloquium wurde daraufhin abgebrochen und mit 5,0, „nicht bestanden“ bewertet.
Jetzt wurde es kompliziert: Gegen die darauffolgende Bekanntgabe des Nichtbestehens und des endgültigen Verlusts des Prüfungsanspruchs legte der Kläger „Einspruch“ ein, den unsere Mandantin mit rechtsmittelfähigem Bescheid zurückwies. Zudem hat unsere Mandantin den Kläger - ebenfalls durch Bescheid - exmatrikuliert. Allein gegen die Exmatrikulation hat der Kläger dann Widerspruch erhoben. Nach dessen Zurückweisung hat er - anwaltlich vertreten - die Klage nur gegen diesen Widerspruchsbescheid erhoben und zusätzlich die Feststellung begehrt, dass er keine Täuschung bei der Vorlage seiner Thesis begangen habe. Damit stellte sich für das dadurch eingeleitete Klageverfahren erstens die Frage, ob die Klage allein gegen den Widerspruchsbescheid zulässig war (oder nicht auch gegen den Ausgangsbeschied hätte erhoben werden müssen) und zweitens, ob die begehrte Feststellung möglich ist, wenn gegen den dies feststellenden Bescheid selbst kein Rechtsmittel geführt wird. Wir waren der Auffassung, dass das beides nicht geht, und zwar bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen. Das Verwaltungsgericht hingegen ließ erkennen, dass es die Klagen möglicherweise doch für zulässig erachten würde. Es wäre dann darauf angekommen, ob die Masterprüfung zu Recht für nicht bestanden erklärt werden durfte, wobei es wiederum einen großen Unterschied machen kann, ob dies wegen Täuschungsversuchs oder mangelhafter Leistung geschah.
Nach einem Jahr Prozessdauer spielte dies allerdings keine Rolle mehr. Weil der Kläger gegen den Bescheid, in dem das endgültige Nichtbestehen festgestellt wurde, länger als ein Jahr auch nach Zurückweisen seines „Einspruchs“ weder den Widerspruch noch die Klage erhoben hatte, war dieser Verwaltungsakt unanfechtbar geworden. Die Grundlage für die Exmatrikulation war daher nicht mehr zu beseitigen.
Das sah das Verwaltungsgericht zwar noch immer anders und wollte in dem Verfahren noch Details klären, um seiner Entscheidung einen ausermittelten Sachverhalt zugrunde legen zu können. Der Kläger war aber für das Gericht nicht mehr erreichbar und sein Prozessvertreter musste mitteilen, dass seine Schreiben an den Kläger mit dem Vermerk, der Adressat sei unbekannt, zurückkommen.
Die Angabe der sogenannten „ladungsfähigen Anschrift“ des Klägers ist eine in jedem Zeitpunkt des Gerichtsprozesses erforderliche Voraussetzung. Sie dient zum Beispiel dazu, dass Gerichtsentscheidungen wirksam zugestellt werden können und dass in den Fällen der Klageabweisung die beklagte Parte ihren Kostenerstattungsanspruch wirksam geltend machen kann. Ausnahmen von diesem Grundsatz können folglich nur in ganz seltenen Fällen gemacht werden, z.B. wenn bei Preisgabe der Adresse gravierende persönliche Nachteile drohen, wofür allerdings im Falle des Klägers nichts ersichtlich war.
Die Klage wurde daher abgewiesen. Eine letzte Kuriosität zum Schluss: Da der Prozessvertreter gegenüber dem Gericht nicht nachzuweisen vermochte, dass er das Mandat gegenüber dem Kläger wirksam niedergelegt hatte - seine Schreiben kamen ja mit dem Vermerk, der Empfänger sei unbekannt, zurück -, konnte diese Entscheidung ihm und damit auch gegenüber dem Kläger - trotz dessen unbekannten Aufenthalts - wirksam zugestellt werden.
Von Teipel & Partner mandatsführend:
Weitere Informationen zu Dr. Jürgen Küttner
- Spezialist im Prüfungsrecht und Beamtenrecht
- Fachanwalt für Verwaltungsrecht seit 2008.
- Promotion zum Dr. „in utroque iure“ (kanonischem und weltlichem Recht)
- Über 500 persönlich geführte Verfahren im Prüfungsrecht/Hochschulrecht
- Erfolge vor dem Bundesverwaltungsgericht (sowohl Revisionsnichtzulassungsbeschwerde als auch Revision) wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache und dem Bundesfinanzhof.
Dr. Jürgen Küttner steht Ihnen insbesondere im Prüfungsrecht und im Beamtenrecht als hochqualifizierter Ansprechpartner zur Verfügung.
Dr. Jürgen Küttner war mandatsführend in folgenden Verfahren
 08.03.2024HochschulrechtPrüfungsrecht
08.03.2024HochschulrechtPrüfungsrechtErfolg bei Prüfungsanfechtung gegen Universität der Bundeswehr München in Masterstudiengang
Erfolgreiche Anfechtung der Exmatrikulation, der Feststellung des Verlustes des Prüfungsanspruchs und der Bewertung von zwei Prüfungsversuchen als nicht bestanden durch RA Dr. Jürgen Küttner von teipel.law 22.02.2024PrüfungsrechtRechtsmittelrecht
22.02.2024PrüfungsrechtRechtsmittelrechtErfolg im Prüfungsrecht: Anfechtung des Nichtbestehens einer Steuerberaterprüfung vor dem Bundesfinanzhof
Die Anfechtung einer als nicht bestanden bewerteten Steuerberaterprüfung hatte vor dem Bundesfinanzhof in München Erfolg. Mandatsführend: RA Dr. Jürgen Küttner von teipel.law 14.02.2024HochschulrechtPrüfungsrecht
14.02.2024HochschulrechtPrüfungsrechtErfolg Prüfungrecht: Prüfungsanfechtung im Studiengang Humanmedizin
Erfolg gegen Universität Ulm: teipel.law erreichen Gewährung eines neuen Prüfungsversuchs an der Universität Ulm nach endgültigem Nichtbestehen 12.02.2024HochschulrechtPrüfungsrecht
12.02.2024HochschulrechtPrüfungsrechtErfolg im Prüfungsrecht: Anfechtung während der Coronapandemie an Universität Ulm erfolgreich
Fehlerhafte Behandlung der Satzung der Universität Ulm aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie durch die Prüfenden der Uni Ulm führt zu erfolgreicher Prüfungsanfechtung 10.02.2024Prüfungsrecht
10.02.2024PrüfungsrechtErfolg bei Prüfungsanfechtung gegen Hochschule des Bundes
Erfolgreiche Anfechtung einer Feststellung eines Täuschungsversuchs in Modulprüfung durch RA Dr. Jürgen Küttner von teipel.law oder: Vom kleinen Einmaleins des Verwaltungsrechts 05.02.2024PromotionsrechtPrüfungsrecht
05.02.2024PromotionsrechtPrüfungsrechtErfolg im Promotionsrecht bei Verteidigung einer Dissertation gegen Plagiatsjäger
Erfolgreiche Abwehr von Plagiatsvorwürfen im Rahmen einer Promotion durch RA Dr. Jürgen Küttner von teipel.law
Weitere Erfolgreiche Verfahren:
 HochschulrechtPrüfungsrechtRechtsmittelrechtMaster07.11.2018
HochschulrechtPrüfungsrechtRechtsmittelrechtMaster07.11.2018Teipel & Partner: Erfolg vor Bayerischem Verwaltungsgerichtshof München im Hochschulrecht gegen Hochschule München
Erfolgreiche Anfechtung des Eignungsfeststellungsverfahrens im Masterstudiengang BWL gegen die Hochschule München vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof München durch Teipel & Partner Rechtsanwälte. Prüfungsrecht11.09.2018
Prüfungsrecht11.09.2018Teipel & Partner | Erfolg gegen Uni Wuppertal bei Prüfungsanfechtung
Teipel und Partner Rechtsanwälte im Prüfungsrecht bereits im Widerspruchsverfahren erfolgreich. Prüfungsrecht03.09.2018
Prüfungsrecht03.09.2018Teipel & Partner | Erneut Erfolg vor Verwaltungsgericht Arnsberg gegen FernUniversität in Hagen im Prüfungsrecht
Teipel & Partner Rechtsanwälte erzielen Erfolg vor Verwaltungsgericht Arnsberg hinsichtlich einer Prüfungsanfechtung im Fach Wirtschaftswissenschaften. Prüfungsrecht31.08.2018
Prüfungsrecht31.08.2018Teipel & Partner: Erfolg in Bayern im Prüfungsrecht
Teipel & Partner Rechtsanwälte erzielen bei bayerischer Universität Erfolg im Widerspruchsverfahren - zwei neue Prüfungsversuche nach endgültigem Nichtbestehen.